VARIOUS ARTISTS
Hearts & Passions
The Inner Side Of Worldmusic
Mit Gewinnspiel in der CD
Spezialpreis 12 Euro
| CD 68.828 |
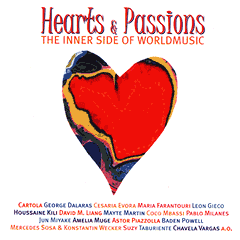 "Hearts & Passions" zeigt die 'innere' Seite der Weltmusik: Gefühle wie Trauer, Hoffnung, Wut und Freude, die in allen Kulturen der Welt beheimatet sind und doch in so unglaublich facettenreichen musikalisch-poetischen Formen ihren Ausdruck finden.
"Hearts & Passions" zeigt die 'innere' Seite der Weltmusik: Gefühle wie Trauer, Hoffnung, Wut und Freude, die in allen Kulturen der Welt beheimatet sind und doch in so unglaublich facettenreichen musikalisch-poetischen Formen ihren Ausdruck finden.Fast 80 Minuten Rembetiko, Fado, Morna, Tango, Bolero, Samba-Cancao, Bossa Nova von international renommierten Künstlern wie Coco Mbassi, Jun Miyake, Cesaria Evora, Mercedes Sosa mit Konstantin Wecker, Astor Piazzolla, Chavela Vargas, Houssaine Kili, Pablo Milanes, George Dalaras, Baden Powell, Maria Farantouri, Amélia Muge, Mayte Martín u.a.
Jeder hat es schon erlebt: da singt oder spielt jemand, und es rührt uns an. In einer Blues-Kneipe in Chicago, in einer Casa de la Trova Havannas, in einer Juerga Flamenca , in einem Fado-Restaurant oder irgendwo ganz am Ende der Welt. Ohne großes Orchester, direkt von Mensch zu Mensch. Und wenn man auch oft die Sprachen nicht versteht, ist die Botschaft musikalisch universell: Hoffnung, Trauer, Liebe, Verzweiflung, Kampf, Enttäuschung.
 |
| Mercedes Sosa - Konstantin Wecker |
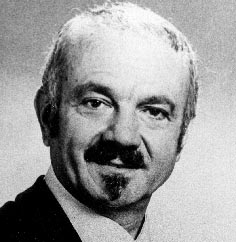 |
| Astor Piazzolla |
 |
| Pablo Milanes - Leon Gieco |
| Cartola |
 |
| Chavela Vargas |
| Alexander Trofimov - Suzy - Claus Schreiner |
Man mag sie auch romantische Lieder oder Kitsch nennen. Die Grenzen sind nun einmal fließend. Denn so ist das Leben.
Als wir 1983 damit begannen, Schallplatten zu veröffentlichen, sprach man noch nicht von Weltmusik oder worldmusic. Vorher war überwiegend Musik aus Lateinamerika und der Karibik seit den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zumeist auf dem Umweg über Nordamerika und dann von Paris aus als exotischer Farbtupfer in die Unterhaltungmusik eingeflossen. Immer wieder tauchten Lieder aus Lateinamerika weltweit in den Charts auf: Rum and Cola (Andrew Sisters), Bananaboat Song (Harry Belafonte), The Lion sleeps tonight (Evening Birds) und Guantanamera (Sandpipers) sind die bekanntesten Beispiele. In den 70er Jahren kamen zahlreiche lateinamerikanische Musiker als politische Flüchtlinge nach Europa. Die DDR spielte damals eine führende Rolle in der Aufnahme dieser Musiker, und in Einrichtungen wie dem Festival des politischen Liedes gelang es, diesen Künstlern Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen. Im Westen war es der Pläne-Verlag in Dortmund, der damals über ausgezeichnete Kontakte in die DDR verfügte und als erster LPs mit Victor Jara, Quilapayun und anderen herausbrachte.
Auf Anregung von Pläne Chef Frickenhaus begann Tropical Music 1983 (gegründet 1976 als Musikverlag), Schallplatten zu veröffentlichen. Heute, im Jahr 2003, blicken wir auf eine Million verkaufte Tonträger zurück. Schon seit den 70er Jahren hatte ich immer wieder von meinen Reisen nach Lateinamerika LPs mitgebracht und mit ihnen die Hoffnungen vieler Künstler, es möge mir gelingen, sie bei einer deutschen Plattenfirma unterzubringen.
Bei einigen Brasilianern hatte das auch geklappt, denn Baden Powell (# 8) hatte eine wahre Begeisterungswelle für brasilianische Gitarrenmusik entfacht, die den Weg ebnen konnte für Sebastião Tapajós oder Egberto Gismonti. Die erste Künstlerin unseres Labels wurde jedoch Mercedes Sosa (#15 mit Konstantin Wecker) und unsere LP No.680.001, das Album Live in Argentinien von 1983, hat sich seitdem über 75.000 mal verkauft. Seit Mercedes spontan den Komponisten ihres großen Erfolges 'Solo le pido a dios' zu einer Tournee mitgebracht hatte, brachten wir auch dessen Schallplatten heraus: Leon Gieco.(# 2)
Ü ber viele Jahre blieb unser Programm lateinamerikanisch und besonders brasilianisch: Milton Nascimento, João Bosco, Sivuca, Martinho da Vila, João Gilberto und andere hatten ihre Deutschland- und Europapremiere bei Tropical Music. Und dann kam Astor Piazzolla . Von ihm hatte es vorher keine LPs in Deutschland gegeben und so veröffentlichten wir Libertango als Beginn seiner Tango Nuevo Konzeption und die nachfolgenden Lumiere (# 12 /Solitude), Persecuta und Biyuya. Auch an Pablo Milanes (# 13) kam niemand vorbei, der sich seit den 80ern mit lateinamerikanischer Musik beschäftigte. So auch wir, und am Morgen nach einem wunderbaren Konzert bei der Midem in Cannes unterschrieben wir mit Pablo einen Vertrag.
1985 mussten wir ein neues Label (Nektar) erfinden. Eine japanische Truppe aus halbnackten Trommlern hatte binnen kürzester Zeit Kultstatus erreicht und unser Abenteuer Japan begann, das uns nach Ondekoza eine Vielzahl faszinierender Klänge und Produktionen eröffnete: Yamashirogumi's AKIRA-Musik, Cicala Mvta, An Chang und zuletzt die Welt des Jun Miyake, in der sich so viele Verbindungen zu unseren eigenen Wurzeln und Begegnungen entdecken liessen. Wie in seiner Liebe zur brasilianischen Musik (# 4 ) oder seinem Bezug auf die Exotica Mode der 50er Jahre.
Nach Nektar musste TAO als weiteres Label kommen, um chinesischer Musik eine Heimat zu geben, wie dem chinesischen Musikprofessor David Minguye Liang (# 16 ), der schon Jahrzehnte in den USA lebt und zusammen mit amerikanischen Musikern zwei wundervolle Alben für TAO einspielte.
Wir gingen wieder einem Geheimtip nach und veröffentlichten das Deutschland-Debut des großen griechischen Sängers George Dalaras (# 10). Es folgte Maria Farantouri (# 7) und seit 1995 waren wir dabei, wann immer Mikis Theodorakis (# 19) in Deutschland wichtige Konzerte gab.
Solche langjährige Begleitungen von Künstlern und ihrem Oeuvre sind ohne freundschaftliche Bindungen zu den Künstlern oder deren Freunde, Verlage und Produzenten nicht denkbar. Wir sind ja nicht selber ständig auf Reisen in die entlegensten Winkel dieser Welt, um Neues zu entdecken. Manches wird uns aufgrund alter Kontakte auch zugetragen. Dazu gehört Chavela Vargas (# 17) aus Mexiko, von der es dort Hunderte von Platten gibt, obwohl sie längst vergessen schien. 1997 kam Chavela nach Bonn, um den Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik für unsere Veröffentlichung selbst entgegen zu nehmen.
Mitte der neunziger Jahre veröffentlichten wir mit Cesaria Evora (# 9) erstmals Musik aus Afrika und begleiteten Cesaria in Deutschland, wann immer sie das Publikum mit ihren wundervillen Mornas verzauberte. Neben anderen afrikanischen Künstlern boten wir auch der in Paris lebenden kameruner Sängerin Sally Nyolo erstmals Gelegenheit sich einem deutschen Publikum vorzustellen. Und dann kam mit Coco Mbassis (# 1, ebenfalls aus Kamerun und in Paris lebend) Debut Platte ein neuer Stil afrikanischer Popmusik, der auf perkussives Übergewicht zugunsten von kammermusikalischen Klängen fast verzichtete.
Es gab eigentlich unter den über 125 Alben veröffentlichten keines, das uns nicht ans Herz gewachsen war und mit Passion vorgestellt wurde. So z.B. den schon 1980 gestorbenen Sambista Cartola (# 14), den ich oft in Rio in nächtlichen Konzerten live gehört hatte.
Als Kanaren-Liebhaber waren mir bei vielen Reisen Los Sabandeños von Teneriffa und Taburiente (# 18) von La Palma aufgefallen - und hier besonders der Sänger Luis Morera, dem ich gern eine größere Beachtung außerhalb der Kanaren gewünscht hätte. Das Iberische hat uns nicht zuletzt über Lateinamerika immer wieder begleitet und in Atem gehalten. Wie Mayte Martin (# 5) aus Spanien mit ihrer sehr eigenen und dennoch als authentisch empfundenen Interpretation des Cante Flamenco, oder die Portugiesin Amélia Muge (# 11), gebürtig aus Mosambik, mit ihren Liedern, die so viele Facetten lusitaner Musik zwischen Fado und Folklore besitzen. Bei beiden findet sich so viel maurischer Einfluß wie wir vermeintlich iberischen Einflüssen in der Musik des Marokkaners Houssaine Kili (# 6) begegnen. Sein Debut Album als Solo-Künstler bei uns versahen wir titelgerecht mit einem Safran-Duft auf dem Silberling.
Claus Schreiner
